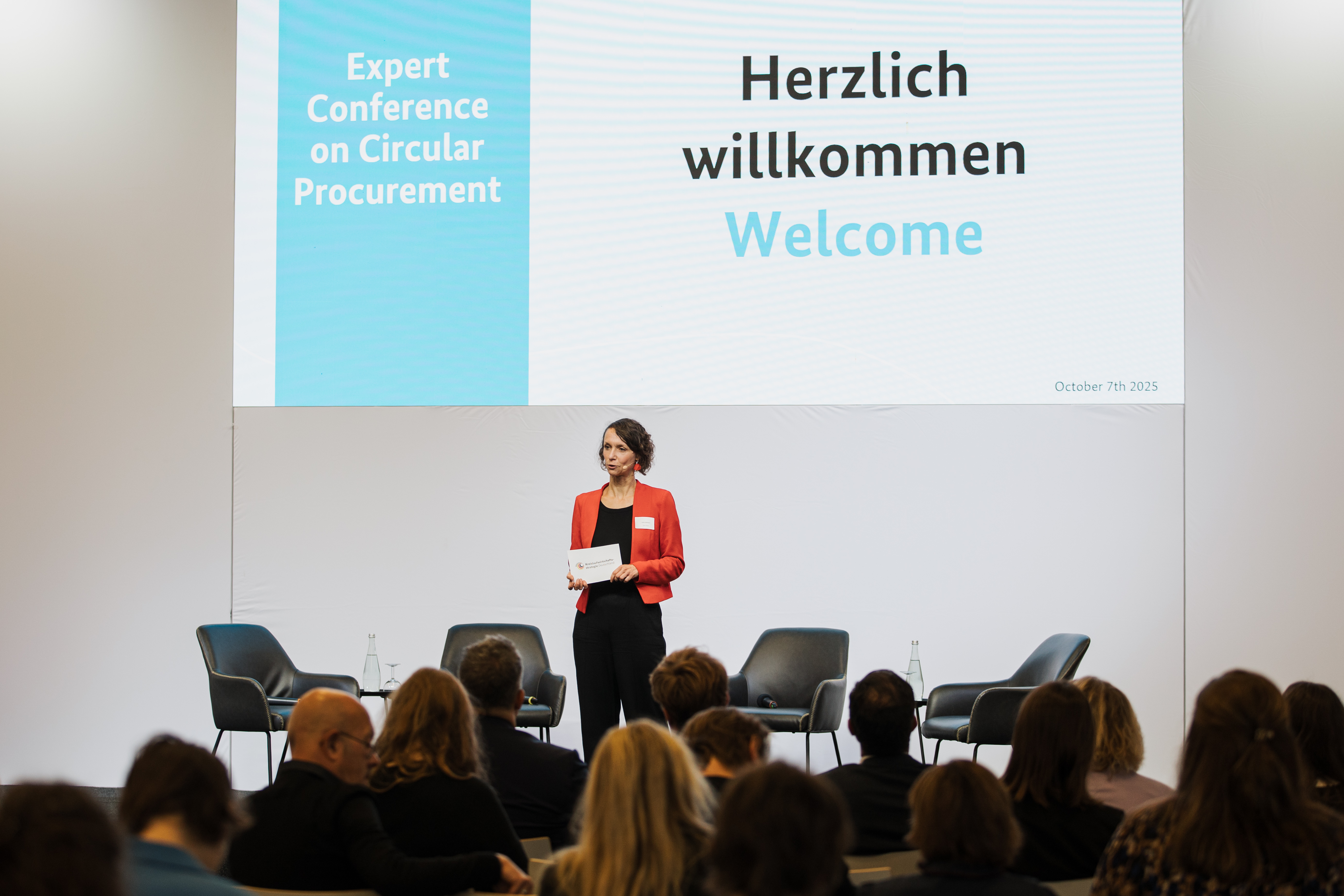Mehr als Verwaltung: Zirkuläre Beschaffung als Hebel für wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation
Rückblick auf die Fachkonferenz Beschaffung zirkulär gestalten – Europäische Perspektiven für eine wirksame Umsetzung
Die NKWS-Fachkonferenz „Beschaffung zirkulär gestalten – Europäische Perspektiven für eine wirksame Umsetzung“ brachte am 7.10.2025 rund 100 Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Berlin und digital zusammen.
Im Mittelpunkt der Konferenz standen aktuelle Entwicklungen und Impulse aus der Europäischen Union. Neben einem Überblick zum Circular Economy Act durch einen Repräsentanten der Europäischen Kommission stellten Vertreterinnen und Vertreter mehrerer europäischer Länder erfolgreiche Ansätze und Strategien für die zirkuläre öffentliche Beschaffung vor. Diese zeigten, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis bereits gelebt wird. Die zweisprachige Veranstaltung bot ein Forum für fachlichen Austausch, Wissenstransfer und die Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren der zirkulären Beschaffung.

Der Parlamentarische Staatssekretär Carsten Träger (BMUKN) eröffnete die Fachkonferenz und unterstrich die weitreichende ökologische, ökonomische und soziale Bedeutung der zirkulären öffentlichen Beschaffung. Sie sei, so Träger, weitaus mehr als ein Verwaltungsinstrument. Sie ist eine Gestaltungsaufgabe mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Tragweite. Gerade die zirkuläre Beschaffung eröffne neue Spielräume.
Der EU-Circular-Economy-Act: Auf dem Weg zu verbindlichen Standards für zirkuläres Wirtschaften

Bericht zum aktuellen Stand des EU Circular Economy Act
von Aurel Ciobanu-Dordea,
Director Competitive Circular
Economy & Clean Industrial Policy (ENV.B)
Zu Beginn der Fachkonferenz stellte Aurel Ciobanu-Dordea, Director Competitive Circular Economy & Clean Industrial Policy der Europäischen Kommission, den aktuellen Diskussionsstand sowie Hürden und Potenziale des Circular Economy Act vor. Dieser soll bis 2026 verbindliche, einfach anwendbare und verifizierbare Kriterien für das zirkuläre Wirtschaften in der EU schaffen. Er erklärte, wie die geplante Regulierung nachhaltige Standards europaweit harmonisieren und insbesondere den Umgang mit ressourcenintensiven Materialien wie Kunststoff verbessern wird.
Ciobanu-Dordea betonte die Bedeutung des gestarteten öffentlichen Konsultationsprozesses, bei dem Stakeholder vor allem eine Verbesserung ökonomischer Anreize forderten, um die Transformation zum zirkulären Wirtschaften zu beschleunigen. Trotz des großen Potenzials der öffentlichen Beschaffung zeige sich, dass deren komplexe Verfahren häufig zur Vermeidung führen, weshalb einfache und verpflichtende Regeln notwendig sind. Diese sollen die lokalen Kreislaufwirtschaftsakteure stärken und die Überprüfung zirkulärer Beschaffungskriterien vor Ort ermöglichen. Insgesamt verdeutlichte der Impulsvortrag, dass der Circular Economy Act ein wichtiger Schritt ist, um Europas Wirtschaft nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und ressourcenschonender zu gestalten.
Spotlight Session: Von der Strategie zur Umsetzung - Praxisbeispiele zirkulärer Beschaffung in Europa
In der Spotlight Session „Circular Procurement in the European Spotlight: Insights from Policy and Practice“ präsentierten Vertreterinnen und Vertreter aus den Niederlanden, Österreich und Deutschland erfolgreiche Praxisbeispiele zirkulärer Beschaffung:
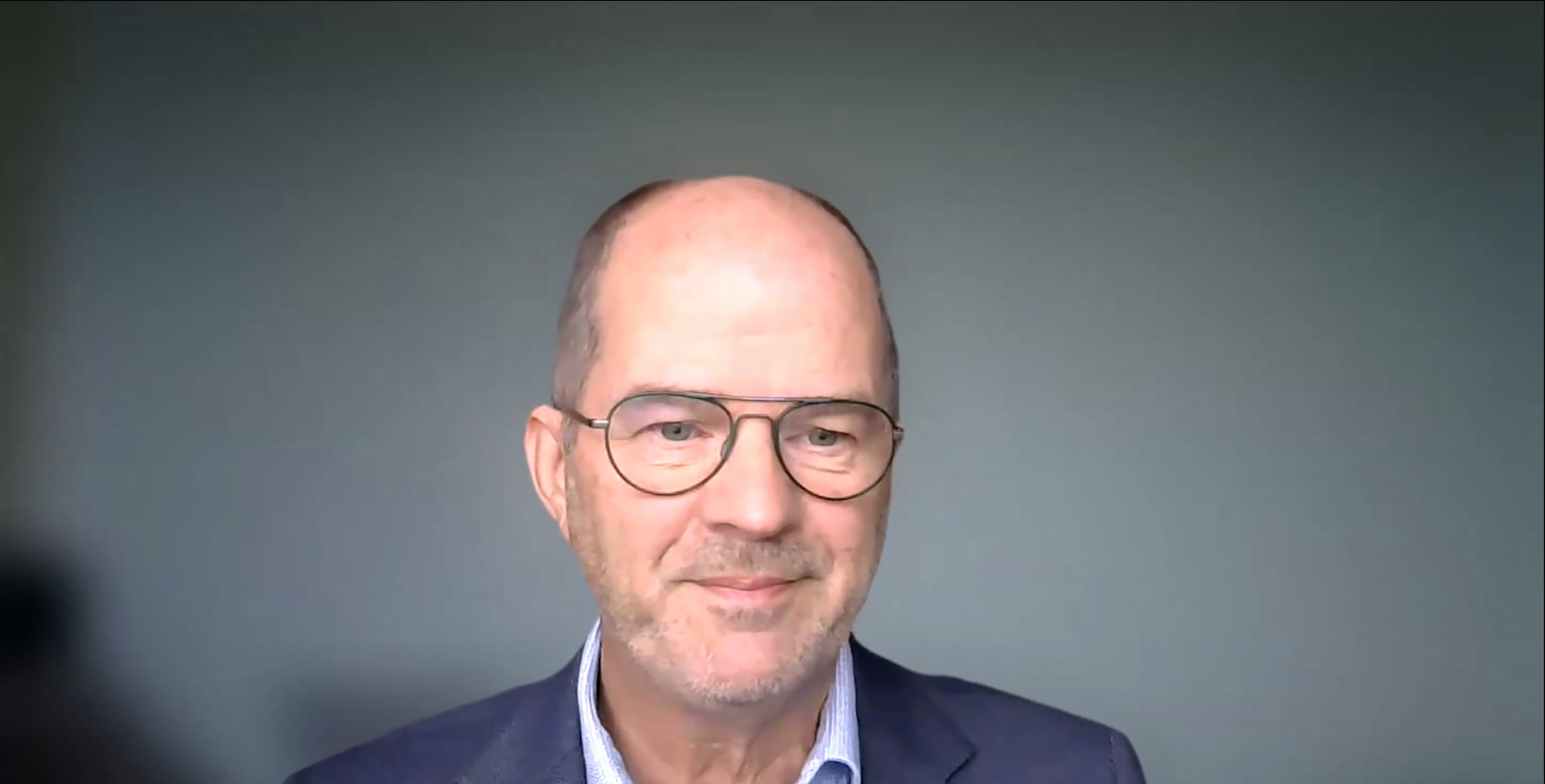
Impuls zu zirkulärer Beschaffung aus den Niederlanden
von Cuno van Geet,
Program Manager Circular Procurement, Ministry of Infrastructure and Water Management (Netherlands)
Aufzeichnung Original (Englisch)
Wie gelingt der Wandel zur zirkulären Beschaffung in den Niederlanden? Cuno van Geet, Programm-Manager Circular Procurement des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, erläuterte, wie die Niederlande durch sektorale Fokusansätze, Abkommen, Werkzeuge und Lernnetzwerke Fortschritte im Bereich der zirkulären Beschaffung erzielen. Digitale Marktplätze und einheitliche Produktlabels spielten dabei eine Schlüsselrolle, auch wenn aktuell noch Verbesserungsbedarf bei der Produktkennzeichnung besteht. Van Geet betonte, dass die EU-Politik zwar wichtige Impulse setze, nationale Gestaltungsspielräume aber weiterhin bestehen und genutzt werden sollten.

Impuls zu zirkulärer Beschaffung aus Österreich
von Dr. Gerhard Weiner,
Head naBe platform, Bundesbeschaffung GmbH (BBG) (Austria)
Aufzeichnung Original (Englisch)
Wie organisiert Österreich die Umsetzung seiner Kreislaufwirtschaftsstrategie? Auf der Fachkonferenz stellte Dr. Gerhard Weiner, Leiter der naBe-Plattform der Bundesbeschaffung GmbH, die Bedeutung des österreichischen naBe-Aktionsplans für die nachhaltige öffentliche Beschaffung vor. Der Aktionsplan schreibt ökologische und soziale Mindeststandards für 16 Produktgruppen vor und dient der öffentlichen Verwaltung als wichtige Informationsplattform. Laut Weiner ist die Transformation zur Kreislaufwirtschaft auf den drei Ebenen Vertragsgestaltung, Lieferantenzusammenarbeit und Produktfokus von besonderer Wichtigkeit. Dabei sei eine verständliche Kommunikation der Veränderungen wesentlich, um Akzeptanz zu fördern.

Impuls zu zirkulärer Beschaffung bei der Deutschen Bahn
von Alexander Walter,
Senior Advisor for Real Estate Management
at Deutsche Bahn AG (Germany)
Setzt die Deutsche Bahn neue Maßstäbe bei der Beschaffung von Büromöbeln? Alexander Walter, Senior Advisor im Real Estate Management der Deutschen Bahn AG, berichtete über den Wandel im Bereich der Büroeinrichtung hin zu einem kreislauforientierten Modell. Mit den seit 2024 geltenden neuen Rahmenverträgen wurden Zielwerte für Recyclinganteile und Recyclingfähigkeit vorgegeben. Dabei stehen sowohl die Umwelt als auch die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Für die Bestandsmöbel plant die Deutsche Bahn ab 2026 eine systematische Weiterverwendung in den Kategorien ReSell (Verkauf), ReBuy (Wiederkauf) und ReFurbish (Aufarbeitung), unterstützt durch enge Kooperationen mit Partnerunternehmen. Zu den Herausforderungen zählen die Erstellung von Ausschreibungen auf Basis nachhaltiger Konzepte, Preisfindung, praktische Umsetzung und die Akzeptanz innovativer Kreislaufmodelle.
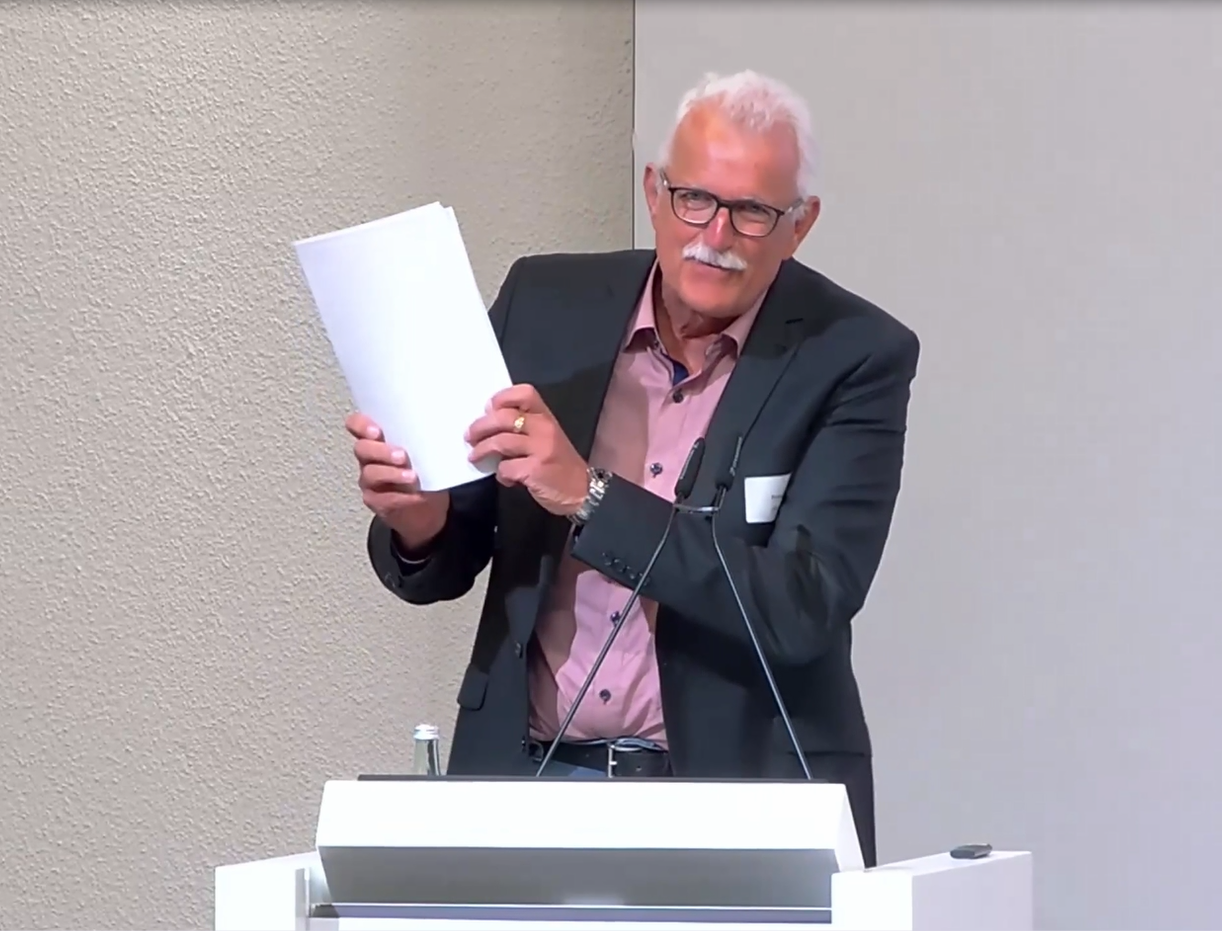
Impuls zu nachhaltiger Beschaffung im Gesundheitswesen
von Thomas Voß,
Former Commercial Director and EMAS Environmental Management Representative at the LWL clinics in Münster and Lengerich (Germany)
Wie lässt sich nachhaltiges Wirtschaften im Gesundheitswesen umsetzen? Thomas Voß, ehemaliger kaufmännischer Direktor und EMAS-Umweltmanagementvertreter der LWL-Kliniken Münster und Lengerich, gab vielfältige Einblicke in die praktische Einführung von Nachhaltigkeit in Krankenhäusern. Dabei reichen die Maßnahmen vom konsequent reduzierten Plastikverbrauch über die Förderung einer nachhaltigen und regional ausgerichteten Küche bis hin zum Einsatz klimafreundlicher Baumaterialien. Laut Voß ist besonders die engagierte Einbindung der Mitarbeitenden hervorzuheben, die er als Schlüssel zum Erfolg betrachtet. Ein ganzheitlicher Ansatz verbindet Umweltschutz mit ökonomischer und sozialer Verantwortung und schafft eine Grundlage für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung.
Paneldiskussion: Deutsche und europäische Erfahrungen fließen zusammen
Unter dem Titel „Unlocking Market Potential and Innovation through Circular Procurement“ diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus EU, Bund und Wirtschaft über Wege, wie eine zirkuläre öffentliche Beschaffung Innovationen fördern und Marktpotenziale freisetzen kann. Einigkeit bestand darin, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie einheitliche Standards entscheidend sind, um Märkte zu öffnen, Bürokratie abzubauen und Beschaffungsprozesse zu vereinfachen. Zudem sollte die öffentliche Beschaffung zukünftig stärker auf Lebenszykluskosten ausgerichtet werden, um Wirtschaftlichkeit, Markttransparenz und Innovationsförderung besser miteinander zu verbinden.
Die Diskussion zeigte auf, dass die Umsetzung der nachhaltigen Beschaffung neue Arbeitsweisen und organisatorische Anpassungen erfordert. Langfristig können sich diese jedoch auch finanziell positiv auswirken. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ambitionierte Nachhaltigkeitskriterien häufig auf überforderte Märkte treffen. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es demnach ein verändertes Bewusstsein sowie belastbare Datengrundlagen, um Fortschritte und Effekte sichtbar zu machen, auch jene, die sich erst langfristig zeigen.
Als zentrale Herausforderungen nannten die Teilnehmenden des Panels die Digitalisierung und das Datenmanagement. Ein digitaler Produktpass könnte hier mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette schaffen, erfordert jedoch einheitliche Standards und qualitativ hochwertige Daten, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen.
Spotlight Session: Von regionalen Impulsen zur zirkulären Transformation
In der Spotlight Session „Unlocking Regional Transformation through Circular Procurement“ gaben die Referierenden Einblick in erfolgreiche lokale Ansätze aus verschiedenen Regionen Europas zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft:

Impuls zu zirkulärer Beschaffung aus Umea, Schweden
von Janet Ågren,
Deputy mayor City of Umeå (Sweden)
Aufzeichnung Original (Englisch)
Janet Ågren, stellvertretende Bürgermeisterin von Umeå, stellte die kommunalen Bemühungen vor, bis 2040 klimaneutral zu werden. Ein systematischer Analyse- und Planungsprozess sowie konkrete Projekte, z. B. zur lokalen Lebensmittelversorgung, sollen den Wandel fördern.

Impuls zu zirkulärer Beschaffung aus Friesland, Niederlande
von Johan Lakke,
Projectmanager Circulair Friesland (Netherlands)
Aufzeichnung Original (Englisch)
Johan Lakke, Projektmanager Circular Friesland, Niederlande, berichtete von der Circulair Friesland Association, einer regionalen Initiative mit vielen KMUs, die durch Vernetzung, Wissensvermittlung und gemeinsame Ausschreibungen die Kreislaufwirtschaft in der Region stärken will.

Impuls zu zirkulärer Beschaffung aus Stuttgart, Deutschland
von Sonja Wegge,
Former Project Manager Circular Economy at the City of Stuttgart (Germany)
Aufzeichnung Original (Englisch)
Sonja Wegge, ehemalige Projektmanagerin der Stadt Stuttgart, zeigte auf, wie öffentliche Beschaffung als Hebel für Emissionsreduktion, Kostenersparnis und regionale Wertschöpfung genutzt werden kann. Hierfür werden spezifische Kriterien für IT-Hardware, Textilien und Möbel entwickelt, die auf Bundesebene abgestimmt sind. Die Stadt positioniert sich als Vorbild und fördert damit eine konsistente und nachhaltige Umsetzung.
Dialogsessions: Praxisnahe Herausforderungen und gemeinsames Lernen
In drei parallel laufenden Dialogsessions diskutierten die Teilnehmenden der Fachkonferenz praxisnahe Herausforderungen zirkulärer Beschaffung. Die Themenpatinnen eröffneten jeweils mit einem kurzen Impuls, leiteten durch ausgewählte Leitfragen und begleiteten die Erarbeitung gemeinsamer Erkenntnisse (Lessons Learned).
Lernimpulse aus anderen EU-Ländern
Wie können erfolgreiche zirkuläre Beschaffungsansätze auf Deutschland übertragen werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Dialogsession „Lernimpulse aus anderen EU-Ländern“. Kathrin Graulich vom Öko-Institut gab einen kompakten Überblick über die gesetzliche und programmatische Verankerung zirkulärer Beschaffung in Deutschland und ausgewählten EU-Staaten, erläuterte bestehende Monitoring-Ansätze und präsentierte länderspezifische Best-Practice-Beispiele.
Die in den „Lessons Learned“ gewonnenen Erkenntnisse zeigen: Entscheidend ist es, ins Handeln zu kommen und auch schon mit einer pragmatischen „80:20-Lösung“ zu starten. Für weitere Fortschritte braucht es vor allem Zeit, politischen Willen, Bewusstsein, Verantwortung sowie Neugier und Mut. Kommunikation und Marktdialoge spielen eine zentrale Rolle, um voneinander zu lernen und gemeinsam voranzukommen.
Inspiration liefern europäische Ansätze, die aufzeigen, dass ein verändertes Mindset ausschlaggebend ist, etwa nach dem Prinzip „Buy less, buy better, use better“, dem Verständnis von Boden als Wert („Soil is a value“) und der Erkenntnis, dass zirkuläre Beschaffung langfristig Kosten spart. Um die Kooperation zwischen Industrie, Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Verbänden zu stärken, gilt es, mittels standardisierter Kriterien mehr Vorhersehbarkeit für den Markt zu schaffen und Best-Practice-Ansätze sichtbar zu machen.
Im Dialog mit dem Markt
Die Session „Im Dialog mit dem Markt“ widmete sich der Rolle, den bisherigen Erfahrungen und den Potenzialen des Instruments Marktdialog für eine wirkungsvolle zirkuläre Beschaffung in Deutschland. Gemeinsam mit Themenpatin Claudia Wieczorek vom Yunus Environment Hub diskutierten die Teilnehmenden über bestehende Hürden bei der Nutzung von Marktdialogen. Dabei wurde deutlich, dass ein größerer Wissensbedarf bei den Beschaffenden besteht, sowohl was die inhaltlichen Kriterien als auch praktische Hilfestellungen angeht. Marktdialoge können hier das Verständnis fördern und einen wertvollen Erfahrungs- und Informationsaustausch bieten. Gleichzeitig wurde betont, dass ihre Wirksamkeit von leicht umsetzbaren und unterstützenden Formaten abhängt. Für einen systematischen und nachhaltigen Austausch wurden verschiedene Formate und Instrumente vorgeschlagen, darunter standardisierte Marktdialogformate, digitale Plattformen mit sektorspezifischen Fokusgruppen sowie regionale und internationale Vernetzungen.
Im Ergebnis dieser Session zeigte sich, dass ein gemeinsamer, abgestimmter Kompetenzaufbau für Beschaffende entscheidend ist. Dabei wurde das Bild einer „Legokiste“ verwendet, bei der aus einem Pool passender Bausteine, wie Recycling-Labels oder klar definierten Kriterien, je nach Bedarf ausgewählt werden kann. Die Bedeutung regionaler Vernetzung und das Potenzial digitaler Lösungen wurden ebenfalls hervorgehoben. Diese Impulse bieten wertvolle Ansatzpunkte für die Umsetzung einer wirksamen zirkulären Beschaffung in Deutschland.
Kooperation auf allen Ebenen stärken
Die dritte Dialogsession mit dem Titel „Kooperation auf allen Ebenen stärken: Synergiepotenziale zwischen Bund, Ländern & Kommunen“ bot Raum für einen Austausch zu Zielen und Formen bestehender Kooperations- und Vernetzungsformate. In der Fishbowl-Diskussion unter der Leitung von Kathrin Maier aus der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung (KNB) im Beschaffungsamt des BMI wurde herausgearbeitet, dass Prozesse am effektivsten mit einem fokussierten Kreis von Stakeholdern vorangebracht werden können. Zudem können Best-Practice-Erfahrungen als wertvolle Impulse für kommunale Akteure dienen. Ergänzt wurde die zentrale Rolle der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, die als Anlaufstelle Informations- und Beratungsangebote für Bund, Länder und Kommunen bereitstellt. Die Zusammenarbeit über die Verwaltungsebenen hinweg wird durch Netzwerke und konkrete Formate wie Einkaufskooperationen, zentrale Vergabestellen und interkommunale Kooperationen gefördert. Unterstützend wirken darüber hinaus Arbeitsgruppen und Bund-Länder-Treffen, die den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch intensivieren. Die Session machte deutlich, dass zielgerichtete Kooperationen und der Austausch bewährter Praktiken zum Erfolg der zirkulären Beschaffung beitragen können.
Am Ende der Fachkonferenz wurden die wichtigsten Erkenntnisse und Impulse aus allen drei Dialogsessions im Plenum vorgestellt, als gemeinsames Fundament für die weitere Umsetzung in Verwaltung, Politik und Praxis.
Ausblick: Die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft vorantreiben
Die Fachkonferenz zeigte eindrücklich, dass nachhaltige öffentliche Beschaffung ein komplexes, zugleich aber wirkungsvolles Instrument für die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft ist. Zirkuläre Beschaffung kann nicht nur den Ressourcenverbrauch senken, sondern ermöglicht auch Einsparpotenziale für öffentliche Haushalte.
Mit Blick auf die kommenden EU-Regulierungen gilt es nun, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es nationalen und regionalen Akteuren erleichtern, mit praktischen Lösungen und innovativen Konzepten die Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben. Digitalisierung, Datenqualität und enge Kooperation aller Beteiligten bleiben dabei wichtige Erfolgsfaktoren.
Abschließend betonte das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), dass diese Fachkonferenz gezeigt habe, wie wichtig der fortlaufende Dialog zwischen allen Beteiligten ist: zwischen Bund, Ländern, Kommunen, europäischen Partnern, der Wissenschaft und der Wirtschaft. Das Ministerium dankte allen Teilnehmenden für den offenen Austausch, die klaren Beiträge und die bekundete Bereitschaft zur Zusammenarbeit.